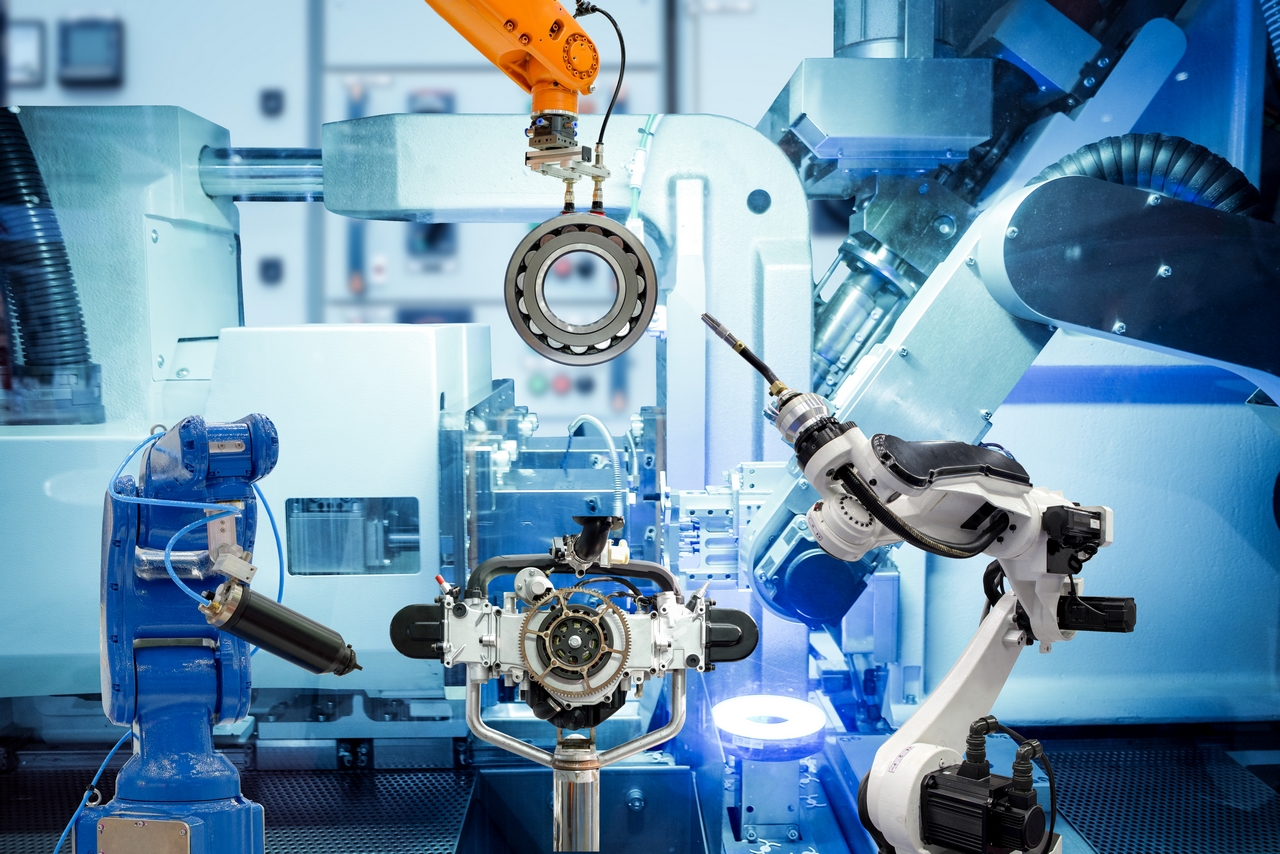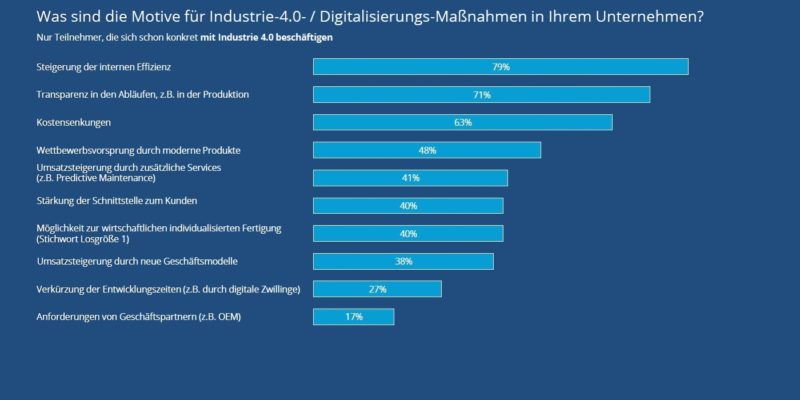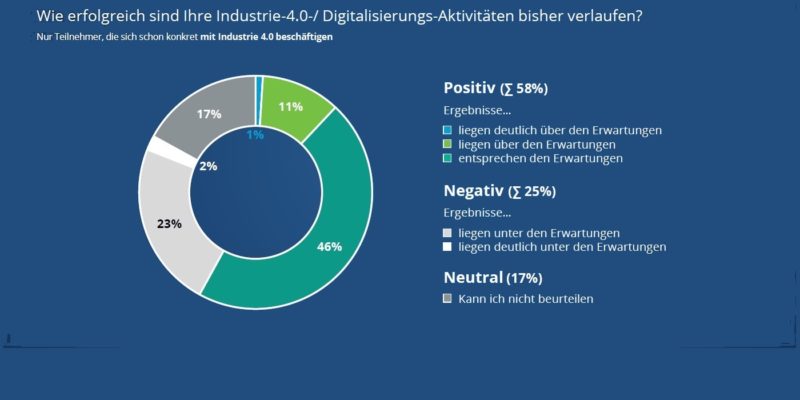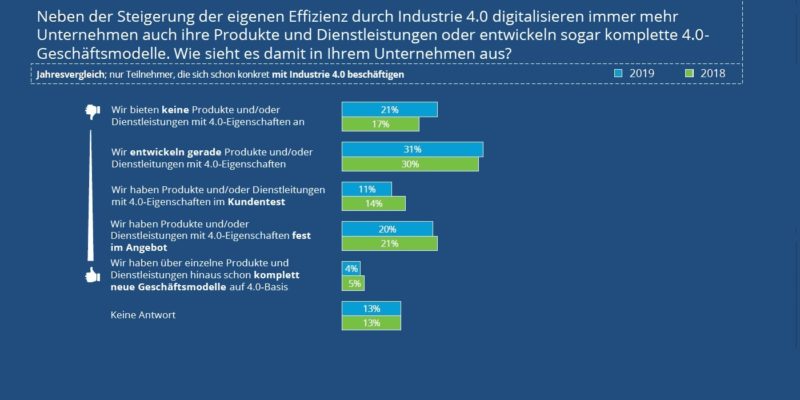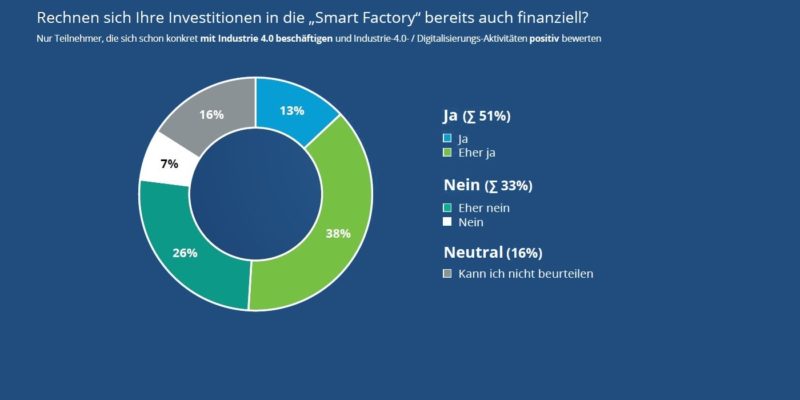Ist das alles wirklich erst seit einem Jahrzehnt unser Alltag? Was haben wir früher eigentlich gemacht, wenn wir wissen wollten, ob es am nächsten Tag regnet? Inzwischen schauen wir für die Antwort ganz automatisch auf das Smartphone. Wenn wir in eine unbekannte Gegend fahren, nutzen wir Google Maps. Wenn wir eine Bahnfahrkarte brauchen, bestellen wir sie mit einer App. Dank Onlineshops können wir spontan etwas kaufen, was wir gerade bei einem Bekannten gesehen haben. Und wenn uns irgendjemand ein leckeres Rezept aus seinem Lieblings-Kochbuch zeigt, fotografieren wir es, statt es abzuschreiben.
Der digitale Reflex: Apps nutzen, ohne es zu merken
So hat sich das Smartphone in unseren Alltag eingeschlichen. Manch einer nutzt beinahe drei Dutzend digitaler Dienste am Tag. Doch fragt man ihn oder sie, so lautet die Antwort: Ich nutze etwa sieben Apps am Tag. Dieses Missverhältnis zeigt, dass viele Leute deutlich mehr Apps nutzen, als sie bewusst wahrnehmen. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung der Cisco-Tochter AppDynamics. Das Unternehmen besitzt durch seine Auswertung der Nutzungsparameter von Apps Information aus erster Hand und hat sie durch eine Befragung von Konsumenten ergänzt. In seinem globalen „App Attention Index“ analysiert der App-Intelligence-Anbieter genau, wie Kunden Apps in der Realität nutzen und welche digitale Customer Experience sie erwarten.
So geben die Befragten an, nur sieben digitale Dienste pro Tag zu nutzen. Doch die harten Nutzungsdaten sprechen eine andere Sprache: Es sind mehr als 30. Doch immerhin ist einem Großteil (68%) der Befragten klar, dass der Einsatz von Apps inzwischen zum „digitalen Reflex“ geworden ist, wie AppDynamics es nennt. Digitale Services werden verstärkt unbewusst genutzt. Ein gutes Beispiel ist der regelmäßige Blick auf die Wetter-App, die zumindest bei den Nutzern von Android-Smartphones ihre Daten direkt auf dem Homescreen anzeigt. Ein zweites gängiges Beispiel ist der regelmäßige Kontrollblick auf WhatsApp, ob bereits eine Reaktion auf eine eben geschriebene Nachricht erfolgt ist.
Die meisten Befragten der Studie schätzten die positiven Auswirkungen auf das tägliche Leben. So sind 70 Prozent überzeugt, dass Apps Stress reduzieren und 68 Prozent denken, dass sie ihre Produktivität zu Hause oder am Arbeitsplatz verbessert haben. In vielen Fällen erfüllen die Apps im Leben der Menschen so wichtige Aufgaben, dass sie kaum darauf verzichten können. 55 Prozent der Befragten gaben an, dass sie höchstens vier Stunden ohne Smartphone auskommen und 50 Prozent greifen nach dem morgendlichen Aufwachen zuerst zum Mobilgerät.
Süchtig nach Social Media und Internet?
Auf viele (meist ältere) Leute, die nur wenig Kontakt mit digitalen Services haben, wirken solche Verhaltensweisen irritierend. Und so werden Grusel-Schlagzeilen wie die folgende gern gelesen: 100.000 Kinder und Jugendliche sind Social-Media-süchtig. Das klingt bedrohlich, doch was steckt wirklich dahinter? Die Zahlen stammen aus einer Studie der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK, in der rund 1.000 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zu ihren Verhalten in sozialen Medien befragt wurden. 26 davon haben einige Kriterien für Suchtverhalten erfüllt. Und hier tauchte wie bei ähnlichen Studien ebenfalls eine Übereinstimmung auf: Einige Jugendliche gaben an, sowohl unter depressiven Stimmungen zu leiden, als auch Social Media übertrieben intensiv zu nutzen.
[toggle title=“Was genau ist Social-Media-Sucht?“]
Die DAK-Studie fragte bei seiner Stichprobe aus Jugendlichen auch das psychometrische Instrument „Social Media Disorder (SMD) Scale“ ab, das von niederländischen Psychologen entwickelt wurde. Es sei sehr gut geeignet, zwischen Vielnutzern einerseits und Personen mit Suchtverhalten andererseits zu unterscheiden, konstatiert eine Analyse des Instruments. Die SMD-Skala basiert auf einem Katalog aus neun Fragen, von denen mindestens Fünf mit „Ja“ beantwortet werden müssen, um Hinweise auf eine Suchtstörung anzuzeigen. Es sind die folgenden neun Fragen, von mir aus dem Englischen in das Deutsche übersetzt:
Wenn Du an das vergangene Jahr denkst:
1. Hast Du schon mal versucht, weniger Zeit mit sozialen Medien zu verbringen, bist aber daran gescheitert?
2. Warst Du regelmäßig unzufrieden, weil du mehr Zeit mit sozialen Medien verbringen wolltest?
3. Hast Du dich oft schlecht gefühlt, wenn du keine sozialen Medien nutzen konntest?
4. Hast Du schon mal versucht, weniger Zeit mit sozialen Medien zu verbringen, bist aber daran gescheitert?
5. Hast Du andere Aktivitäten wie etwa Hobbys oder Sport häufig vernachlässigt, weil du soziale Medien nutzen wolltest?
6. Hast Du regelmäßig Streit mit anderen wegen deiner Nutzung von sozialen Medien?
7. Hast Du Eltern oder Freunde häufiger über die Zeit angelogen, die Du mit sozialen Medien verbringst?
8. Hast Du oft soziale Medien genutzt, um negativen Gefühlen zu entkommen?
9. Hast Du wegen deiner Nutzung von sozialen Medien ernsthafte Konflikte mit deinen Eltern oder Geschwistern?
Es handelt sich hier um eine Skala, die in erster Linie ein Diagnoseinstrument für eine einzelne Person ist. Es ist schwierig, sie auf eine soziologische Untersuchung zu übertragen – der familiäre und soziale Kontext der Kinder und Jugendlichen ist nicht bekannt. So müsste ein Psychologe erst ein längeres Anamnesegespräch mit Kindern oder Jugendlichen führen, um das vermutete Suchtverhalten zu bestätigen – und vor allem, um eine damit verbundene Depression zu diagnostizieren. In der Soziologie wäre das durch eine einzelne quantitative Studie nicht zu leisten, sondern würde umfangreiche und teure qualitative Studien erfordern. Auf jeden Fall gilt für die SMD-Skala : Die Anzahl und Art der Antworten allein ist lediglich ein Anfangsverdacht.
[/toggle]
Solche Ergebnisse gibt es bei zahlreichen soziologischen Untersuchungen. Immer wieder tauchen Korrelationen zwischen Intensivnutzung von Internet, Games und Social Media einerseits und Depressionen andererseits auf. Eine Kausalität lässt sich hieraus nicht ableiten – obwohl es in den meisten Medien immer getan wird („Instagram macht Mädchen depressiv“). Eines der wichtigsten Probleme dabei ist die Unschärfe der Fragen und Instrumente. Sie geht zurück auf einen Mangel an gut bewährten soziologischen Erkenntnissen über Jugend und Digitales; etliche Studien reflektieren lediglich allgemeine Vorurteile über die Jugend oder das Internet. Eine Ausnahme sind eine Grundlagenstudie von 2014 und die auf ihr aufbauende Nachfolgestudie von 2018, beide vom Sinus-Institut in Heidelberg.
[toggle title=“Jugend & Internet – die Sinus-Studien“]
In diesen Studien überträgt Sinus den von ihm entwickelten Milieuansatz auf die Internetnutzung von neun bis 24-jährigen. Im Einzelnen geht es um folgende Milieus bzw. Lebenswelten: Verantwortungsbedachte und Skeptiker sind eher defensiv und vorsichtig. Pragmatische und Unbekümmerte haben einen ausgeprägten Teilhabewunsch, ihr Leben spielt sich deshalb größtenteils online ab. Sie sehen sich nicht unbedingt als Experten und pflegen einen pragmatischen, teils unbedarften Online-Stil. Enthusiasten und Souveräne sind Intensiv-Onliner mit unterschiedlich ausgeprägter Grundhaltung. Während die Enthusiasten Risiken eher ausblenden, sind die Souveränen kritisch und suchen einen Weg, selbstbewusst mit Online-Gefahren umzugehen.
Soweit der Status 2014. in den folgenden vier Jahren haben sich einige Veränderungen ergeben. So musste Sinus für die 2018er-Studie das Kriterium der Internetferne streichen, es ist kein konstituierende Merkmal für ein Milieu mehr. Denn bei den derzeit Unter-25-jährigen gibt es keine Offliner. Das Internet ist fester Bestandteil ihres Alltags und nicht mehr optional. Wer sich hier bewusst dagegen entscheidet, ist in seiner Teilhabe eingeschränkt. Das ist Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich bewusst. Für sie ist es keine Frage mehr, das Internet zu nutzen. Es geht stattdessen nur noch um das Wie.
Die Studien sind interessanter Lesestoff und bieten viele Erkenntnisse. Eine von zahlreichen: Kinder und Jugendliche sind ihrer eigenen Online-Nutzung deutlich skeptischer gegenüber eingestellt, als es den Eindruck macht. Zwar können sie sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen, doch fast jeder dritte Jugendliche nimmt das eigene Nutzungsverhalten als problematisch wahr. Zudem fürchten zahlreiche Jugendliche typische Gefahren wie Cybermobbing oder Identitätsdiebstahl.
Trotz ihrer Informiertheit über die Gefahren fühlen sich viele Jugendliche eher schlecht auf ihre persönliche digitale Zukunft vorbereitet. Eine wachsende Gruppe erkennt, dass sie sich lediglich virtuos auf Oberflächen bewegt, aber von den technischen Hintergründen keine Ahnung hat. Das zu ändern, wäre natürlich eine Aufgabe für das Bildungssystem. Aber leider ist die Institution Schule eher nonline…
[/toggle]
Die Studien zeigen deutlich, dass junge Leute zu einem souveränen, aber untechnischen Umgang mit der digitalen Welt neigen. Kurz: Sie sind digitale Konsumenten. Und natürlich gibt es auch hier ein Zuviel des Konsums. Eine eingebaute Tendenz zur Dauernutzung haben vor allem spielerische Angebote mit hoher Attraktivität und einer eingebauten, ebenfalls sehr attraktiven Belohnung – etwa Aufmerksamkeit durch Zustimmung und Lob anderer Nutzer. Sucht-ähnliches Verhalten betrifft aber nur eine kleine Minderheit und die auslösenden Faktoren sind nicht hinreichend geklärt.
Die große Mehrheit
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat digitale Dienste in ihre Lebenswelt
integriert, vor allem Spiele und Social Media. Sie werden genutzt, weil sie da
sind und weil sie praktisch sind. Oft handelt es sich aber auch um Jugendkultur-Phänomene,
die nur von einer bestimmten Altersgruppe oder einigen Jahrgangskohorten sehr
intensiv genutzt werden. Anschließend werden die entsprechenden Apps
uninteressant und verschwinden in Einzelfällen sogar vom Markt, wie
beispielsweise Musical.ly.
Die App-Konsumenten der Zukunft
Die Sinus-Studien stellen eine recht große Heterogenität der Nutzung von digitalen Diensten fest, doch auch einige Gemeinsamkeiten in allen Milieus: Es gibt keine Offliner mehr und digitale Services werden als Bestandteil des täglichen Lebens akzeptiert – von einigen sehr enthusiastisch, von anderen auch kritisch. Aus Sicht von Unternehmen ist das eine interessante Konsumentengruppe: Sie nutzen Fun- und Game-Apps besonders intensiv, sind aber auch aber auch offen für Marketing-Apps und andere digitale Angebote von Unternehmen.
Doch genau diese Konsumentengruppe ist anspruchsvoll und somit wird der durchschnittliche App-Nutzer auch immer mäkeliger. Die App-Dynamics-Studie konstatiert eine Null-Toleranz-Einstellung gegenüber schlechten digitalen Diensten. So gaben etwa drei Viertel der Befragten an, dass in der letzten Zeit ihre Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Apps gestiegen sind. Eine Mehrheit von 70 Prozent toleriert keine technischen und sonstigen Probleme mit den Apps. Auch wenn die freiwillige Angabe von Zahlungsbereitschaft immer etwas problematisch ist: Immerhin jeder zweite der Befragten würde für digitale Produkte und Services einen höheren Preis in Kauf nehmen, wenn die Qualität höher ist als bei den Mitbewerbern.
Verbraucher
verzeihen schlechte Erfahrungen nicht mehr einfach so: Sie wechseln zum
Wettbewerber (49%) oder raten anderen von der Nutzung des Dienstes oder der
Marke ab (63%). Aus der Studie lassen sich zwei wichtige Anforderungen
ableiten, den Unternehmen bei der Entwicklung ihrer digitalen Services beachten
sollten:
- Arbeitsgeschwindigkeit: Die Leistung der Anwendung steht im Vordergrund. Ruckeln, lange Reaktionszeiten, endlose Datenübertragungen – all das macht für die Verbraucher einen schlechten Service. Da moderne Apps meist keine lokale Anwendungslogik mehr haben, sondern ein Cloud-Backend, ist Application Performance Management (APM) das Entdecken und Beheben von Problemen notwendig. Anbei sollte der gesamte Technologie-Stack vom Frontend über das Backend bis hin zum Netzwerk in Echtzeit überwacht werden.
- Benutzererfahrung: Wichtig ist auch eine moderne, leicht verständliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Das klingt wie eine Binse, ist aber leider immer noch nicht selbstverständlich. UX/UI-Design (User Experience, User Interface) ist heute eine eigene Disziplin des Software-Engineering und muss von den Unternehmen ernst genommen werden. Vor allem die nachwachsenden Generationen sind in dieser Hinsicht anspruchsvoll, sie erwarten eine intuitive Bedienung, die keine Fragen offen lässt.
Bildquelle:
TeroVesalainen / Pixabay