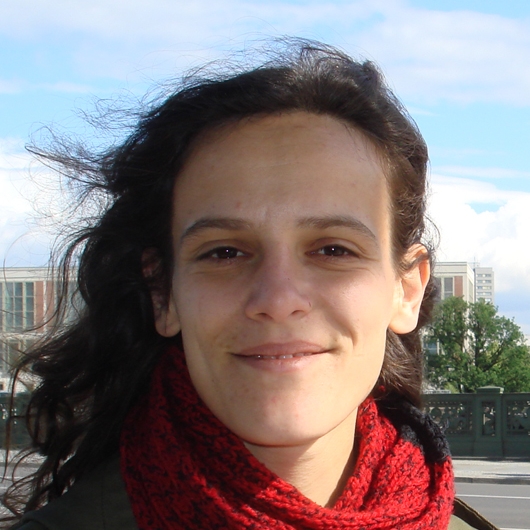„Na?“ Ich erkenne Myriams leicht kehlige, ins Dunkle gehende Stimme sofort, auch um diese Zeit. In San Francisco ist es halb acht Uhr abends und ihre Schicht in der Cafeteria endet gerade. Dort gibt es nur ein Münztelefon, deshalb ruft sie mich kurz an und ich rufe zurück — eine Stunde Reden für 60 Mark. Es ist ein heißer Sommer mit einem leichten Schlaf. Ihre Stimme ist aufgekratzt, ein wenig triumphierend. „Ich habe es, eine Erstausgabe, im roten Umschlag.“
Sie atmet hörbar, von einem leichten Satellitenecho untermalt. Ich bin sofort hellwach. Thomas Pynchon. Gravity’s Rainbow. Die Enden der Parabel. „Jeder lange Haarschnitt ist eine Reise.“ Eine Echokammer und ein Assoziationsraum; mit Anspielungen auf alles und jeden; Kaskaden der Erinnerung an TV-Serien, Comics, Filmen und Büchern. „Herrje, du bist ja ganz ergriffen.“ Diesmal ist es ein amüsiertes Lächeln, das ich über die paar tausend Kilometer heraushören kann. Ich war wohl einen Moment ganz still. „Nächstes Jahr bringe ich es mit.“
Dann beginnt sie zu erzählen, wie jeden Abend und Morgen, an dem sie anruft. Sie erzählt von ihrem Jahr 1989 in einer fremden Welt, erzählt, dass Amerika wie ein Film ist und trotzdem ganz anders. „Ich muss dir was erzählen“, beginnt sie ihre Anrufe. Sie klingt jetzt heiser. Ein paar Wochen hat sie in ihrem Toyota Carina übernachtet, auf einer Reise durch den Westen. Doch der Wagen ist schon länger ihre Wohnung. Das Geld von der Cafeteria reicht nicht für die Mieten in der Bay Area.
Der Mann, mit dem sie zusammen ist; ein Deutscher, er lebt in einem Camper. Er ist in den USA hängen geblieben. „Vielleicht bleibe ich ja auch hier hängen.“ Sie hat eine Wohnung in Aussicht, ein winziges Zimmer in einer WG mit zwei Jazzmusikern. Sie wird mit ihnen Cajun-Gerichte kochen und ein nach New York klingendes Englisch sprechen.
Eine Frau ist ihr in den Carina gefahren. Ohne Versicherung bekommt sie nicht einmal den Schaden voll ersetzt. Aber am selben Abend lernt sie in der Cafeteria einen Anwalt kennen. Nach ein paar Monaten hat sie das Geld für den Wagen. „Das ist die amerikanische Art der Umverteilung.“ Myriam findet schnell Kontakt zu Menschen. Das Ehepaar, dessen Haus in Russian Hill sie zwei Wochen lang hütet, trifft sie auf der Lombard Street, als sie die Serpentinen hinaufläuft. „Sie haben gelacht und gemeint, ich könne nicht von hier sein.“
Wir gewöhnen uns an diese Gespräche, brauchen sie als intimes Ritual. Mein Leben ist geruhsam; ich studiere, schreibe Artikel für eine Lokalzeitung, besuche meine Großmutter und mache dort die Wäsche von zwei Wochen. Manchmal gehe ich aus und fast nie lerne ich Frauen kennen. Myriam erlebt jeden Tag einen Roman. „Die Gespräche helfen mir“, sagt sie eines Morgens. „Ich gebe dir meine Erlebnisse; wie einem Treuhänder. Du sollst mir später bestätigen, dass ich das wirklich alles erlebt habe.“
Myriam ruft manchmal ein paar Tage hintereinander an, dann wieder einige Zeit gar nicht. Ich warte auf den Anruf, schlafe unruhig, bis es soweit ist. Ich lebe im Nebel der Unausgeschlafenheit, bin erschöpft — von der Warterei, von den kurzen Nächten, vom konzentrierten Zuhören, vom Satellitenecho unserer Gespräche. Ihre Stimme klingt nah, wie in meinem Kopf. „Ich muss dir was erzählen.“ Manchmal höre ich sie mitten am Tag und drehe mich verwirrt um.
Es wird Herbst. Ich habe das Semester geschmissen und angefangen, im Altenpflegeheim zu arbeiten, dem Ort meines Zivildienstes. Meine Telefonrechnungen bezahle ich pünktlich am Postschalter, mit ein, zwei Hundertern in der Hand. Ich arbeite in der Frühschicht; mal in der Gerontopsychatrie, mal auf einer Pflegestation. Die Arbeit ist anstrengend und hektisch. Wenn ich mich von Myriam verabschiedet habe, dusche ich und fahre los.
Eines Abends im Oktober schalte ich meinen Fernseher ein. Ein schweres Erdbeben in San Francisco. Ich weiß, dass Myriam wieder mit ihrem verbeulten Carina unterwegs ist. Trotzdem kann ich in der Nacht nicht schlafen, hoffe auf einen Anruf. Um sechs Uhr melde ich mich im Altenheim krank; schlafe ein und werde vormittags durch das Telefon aufgeschreckt. Sie hat stundenlang Freunde angerufen, es immer wieder versucht, bis sie wusste: es ist niemand verletzt. „Es war anfangs nur ein dumpfes Grollen, hat Steven gesagt. Dann hat alles vibriert und gewackelt.“
Es ist fast Winter, als sie plötzlich von Deutschland hört. Sie ruft mich mitten am Tag an, es ist tiefe Nacht bei ihr. „Ich bin auf einer Party.“ CNN bringt den Mauerfall als Breaking News, zeigt die Leute, wie sie auf der Mauer tanzen und kleine Steinchen daraus schlagen. In Köln dauert es zwei Wochen, bis die ersten Trabante und Wartburge auftauchen. Eines Morgens dann der Anruf: „Ich komme zurück, nächste Woche.“
Myriam geht langsam durch die Menschen, blickt suchend um sich. Dann hat sie mich entdeckt. Sie strahlt, reißt die Handtasche hoch. „Da ist es drin.“ Dann gluckst sie, wirft ihre sonnenhellen Haare nach hinten und pustet die Strähne auf der Stirn nach oben. So, wie sie es schon immer getan hat, kräftig, mit leicht vorgeschobenem Unterkiefer. Es lässt Myriam trotzig aussehen. Ich lache. Wir schauen uns an.
(2008)
Bildquelle: Oscar Fernando Melo Cruz / Pixabay