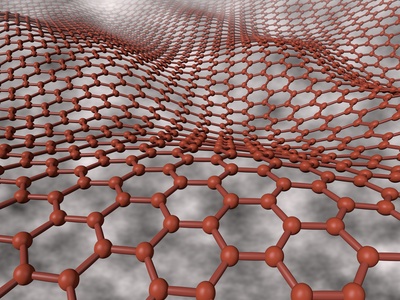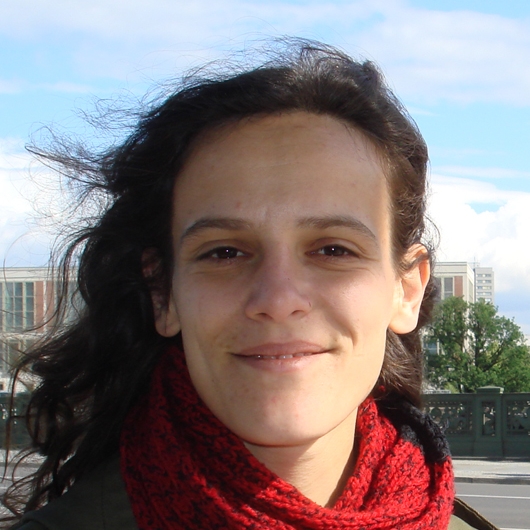Seit ein paar Monaten bin ich Blendle-Nutzer. Von der Idee war (und bin) ich total begeistert. Aber inzwischen bin ich zu einem zwiespältigen Urteil gelangt: Das Blendle-Konzept ist super, nur in der Praxis gibt es da einige Probleme. Aber der Reihe nach:
Blendle ein unglaublich toller Service, ein Pressekiosk mit Einzelverkauf der Artikel für vergleichsweise kleines Geld. Die App ist eine Lösung für ein altes Problem, denn wer liest schon eine ganze Zeitung. Auf der anderen Seite hatten viele schon immer den Wunsch, mehrere Tageszeitungen zu lesen, um sich breiter zu informieren.
Das war allerdings in der guten alten Zeit eine teure Angelegenheit. Bei Blendle dagegen werden die Kosten durch den Einzelverkauf überschaubar. Und natürlich hätte man als Abonnent von 3-4 Tageszeitungen auch nicht jeden Tag in jedem Blatt unbedingt etwas Lesenswertes gefunden. Für eilige Überschriften-Überflieger mit Termindruck im Nacken ist so ein Tageszeitungsabo schon ein enormer Luxus.
Blendle ist eine tolle App
Das ist also der große Vorteil von Blendle: Die gesamte Breite der deutschen Tages- und Wochenpresse sowie von immer mehr internationalen Blättern ist verfügbar. Anhand von Überschriften und dem ersten Dutzend Zeilen der Artikel ist im Normalfall recht gut zu entscheiden, ob sich das Lesen und die Ausgabe eines Betrages ab 15 Cent lohnt.
Und wer sich verklickt und den Artikel direkt wieder schließt, muss überhaupt nichts bezahlen. Außerdem gibt es eine sehr angelsächsisch anmutende Geld-zurück-Garantie: Wer den Beitrag wider Erwarten doch nicht gut findet, kann innerhalb von 24 Stunden sein Geld wieder zurückfordern. Das geht ganz einfach mit einem Menübefehl und ohne weitere Begründung.
Diese Möglichkeiten sind sehr praktisch und außerdem ist die Blendle-App auf der Höhe der Zeit: Elegante Gestaltung, gut lesbar dargestellte Artikel und ein responsives Design. Verzögerungen beim Laden der Artikel gibt es eigentlich nicht und auch die sonstigen Funktionen reagieren recht schnell. Das ist allerdings eher ein Randthema, denn es handelt sich in erster Linie um eine Leseapp.
Einen kleines Manko ist das Fehlen der Möglichkeit, die Schriftgröße anzupassen. Außerdem gibt es hin und wieder kleinere Mängel in der Typografie. Das wird allerdings meist an der Datenquelle eines Artikels liegen. Sie kommen wohl im Regelfall direkt aus dem Redaktionssystem und werden offensichtlich hin und wieder beim Konvertieren zerschossen.
Neben dem Lesen ist die Suche nach Artikeln eine fundamentale Funktion. Hier gibt es eigentlich wenig zu meckern. Ergänzend zur handelsüblichen Suche in der gesamten Artikel-Datenbank gibt es auch eine ausgesprochen nützliche Alert-Funktion. Hier können verschiedene Suchbegriffe definiert werden, die ständig aktuell gehalten werden. In einer übersichtlichen Registerleiste stehen alle Alerts bereit und zeigen nach dem Anklicken die gefundenen Artikel.
Ein unerwarteter Mehrwert liegt übrigens in den „ähnlichen Artikeln“, die am Ende jedes Artikels angezeigt werden: Die Funktion deckt Themen-Konjunkturen auf, also eine Situation, in der plötzlich ein Medium über ein bestimmtes Thema berichtet und nun plötzlich alle anderen auf den Zug aufspringen. Wer das Geld investiert und alle Artikel anschaut, kann sich recht gut darüber informieren, welches Medium den Vorreiter macht und welche erst später auf den Zug aufspringen.
So viel zu den zahlreichen, eindeutig positiven Seiten von Blendle. Und jetzt ein paar kritische Anmerkungen. Dabei möchte ich mich nicht mit Krittelei an einzelnen Funktionen aufhalten. Das sind Dinge, die sich sehr leicht ändern lassen und hoffentlich auch schon im Backlog der Entwickler zu finden sind – etwa die fehlenden Inhaltsverzeichnisse. Unverständlich, dass es nicht möglich ist, sich ohne lästiges Durchscrollen ganzer Ausgaben über den Inhalt zu informieren.
Deutsche Verlage verstehen Blendle nicht
Ein Problem, für das Blendle vermutlich ebenfalls nicht besonders viel kann, sind die Preise. In anderen Ländern, etwa in niederländischen oder englischen Medien, liegen die Durchschnittspreise für einen einzelnen Artikel zwischen 15 und 29 Cent. Die deutschen Preise dagegen liegen im Regelfall deutlich höher, oft bis 79 Cent. Einige Magazine verlangen pro Artikel sogar noch deutlich mehr.Sobald man beim Stöbern mehr als zwei interessante Artikel findet, macht es Sinn, die Gesamtausgabe zu kaufen. Glücklicherweise werden die in einer Ausgabe gekauften Artikel darauf angerechnet. Anders dagegen Zeitungen in den stärker digitalisierten (weil gesellschaftlich moderneren und liberaleren) Niederlanden, zum Beispiel das traditionsreiche NRC Handelsblad. Hier kosten sogar doppelseitige Artikel nur 29 Cent.
Die deutschen Preise sind für die Kalkulation eines persönlichen Etats bei Blendle eher schlecht. Ein (vereinfachtes) Rechenbeispiel: Eine Publikation kostet 1,80 Euro pro Ausgabe. Zu niederländischen Preisen lassen sich also 5 bis 12 Artikel lesen – je nach Einzelpreis. Bei zahlreichen deutschen Publikationen sind die Preise 45 oder 79 Cent, also sind nur zwei bis maximal vier Artikel drin, bevor die gesamte Ausgabe günstiger kommt.
Wer also beispielsweise zwanzig Euro im Monat bei Blendle ausgeben möchte, bekommt als Niederländer also mindestens doppelt so viele und häufig sogar dreimal so viele Artikel wie in Deutschland – klingt nach dem besseren Deal. Und das war sicher einer der Gründe für den Erfolg von Blendle in unserem digital aufgeschlossenem Nachbarland.
Ein zweites Problem: Viele Artikel, die anfangs noch hinter einer Bezahlschranke verborgen sind, tauchen nach einiger Zeit im frei zugänglichen Web auf. Bei Blendle müssen sie dann trotzdem noch bezahlt werden. Immerhin gibt es eine Möglichkeit, sein Abo in Blendle anzumelden und dadurch die Kosten für die entsprechenden Artikel zu sparen. Leider nutzen aber noch lange nicht alle deutschen Verlage diese Möglichkeit, hier wäre ein wenig mehr Engagement vonnöten.
Außerdem hat Blendle die Inhalte der deutschen Medien in der Regel nur für 30 Tage zur Verfügung, anschließend werden die Artikel zwar noch gefunden, können aber nicht mehr gekauft werden. Auch hier agieren die Niederländer digitaler: Auch Monate alte Artikel werden im Normalfall angezeigt und kosten bei einigen Medien nur noch einen Cent.
Einzelverkauf wird nicht ernst genommen
Dass in Deutschland ein einzelner Artikel teils halb so viel wie das ganze Nachrichtenmagazin kostet, zeigt deutlich die Mentalität der deutschen Pressehäuser: Sie denken immer noch in gebündelten Einheiten. Der Einzelverkauf wird nicht recht ernst genommen und ein möglicher Long-Tail-Boom durch hohe Preise und kurze Speicherfristen erstickt.
Die Frage ist, ob dies zu einer dauerhaften Bindung an Blendle führt. Gut möglich, dass sich viele Leute verschaukelt fühlen und der App dann langfristig den Rücken kehren. Das wäre schade, denn das Grundkonzept ist 100% richtig und hätte bereits vor Jahren eingeführt werden müssen: Einzelverkauf von Artikeln aller wichtigen Medien auf einer komfortablen Plattform.
Doch die vielen Umstände, die das Lesen der deutschen Medien mit Blendle bereitet, scheint darauf hinzudeuten, dass die Digitalisierung immer noch äußerst halbherzig vorangetrieben wird. Ob das reicht, um die nächsten 10-15 Jahre zu überstehen?
Bildquelle: © Orlando Bellini / fotolia.com